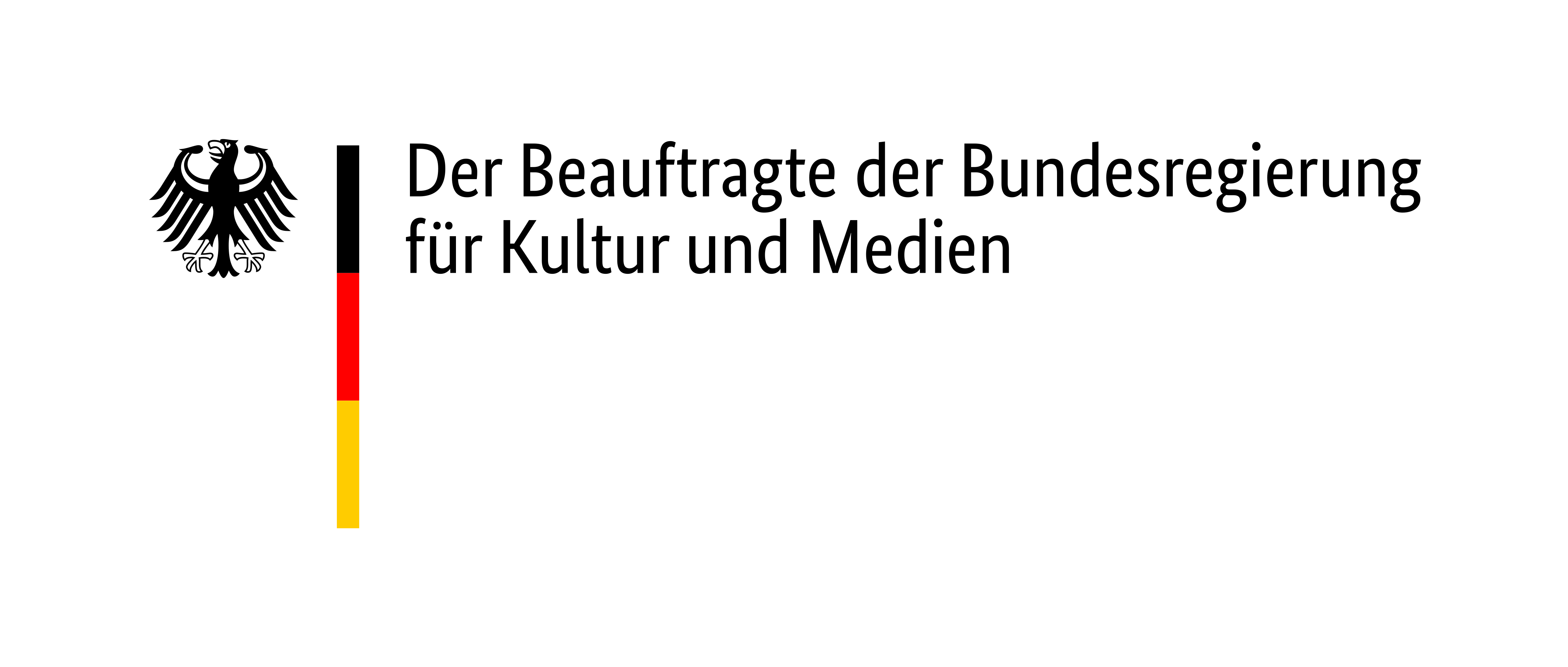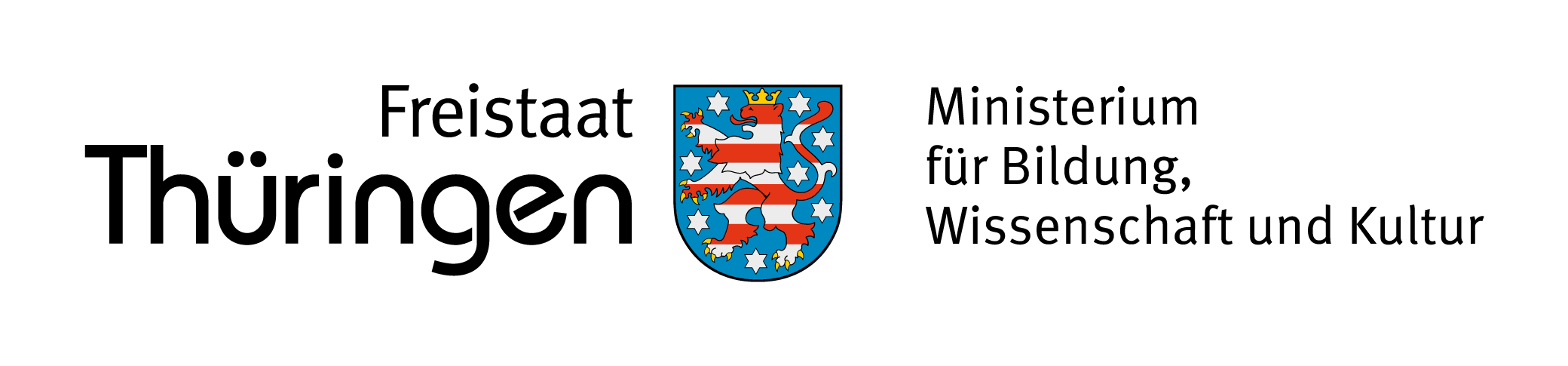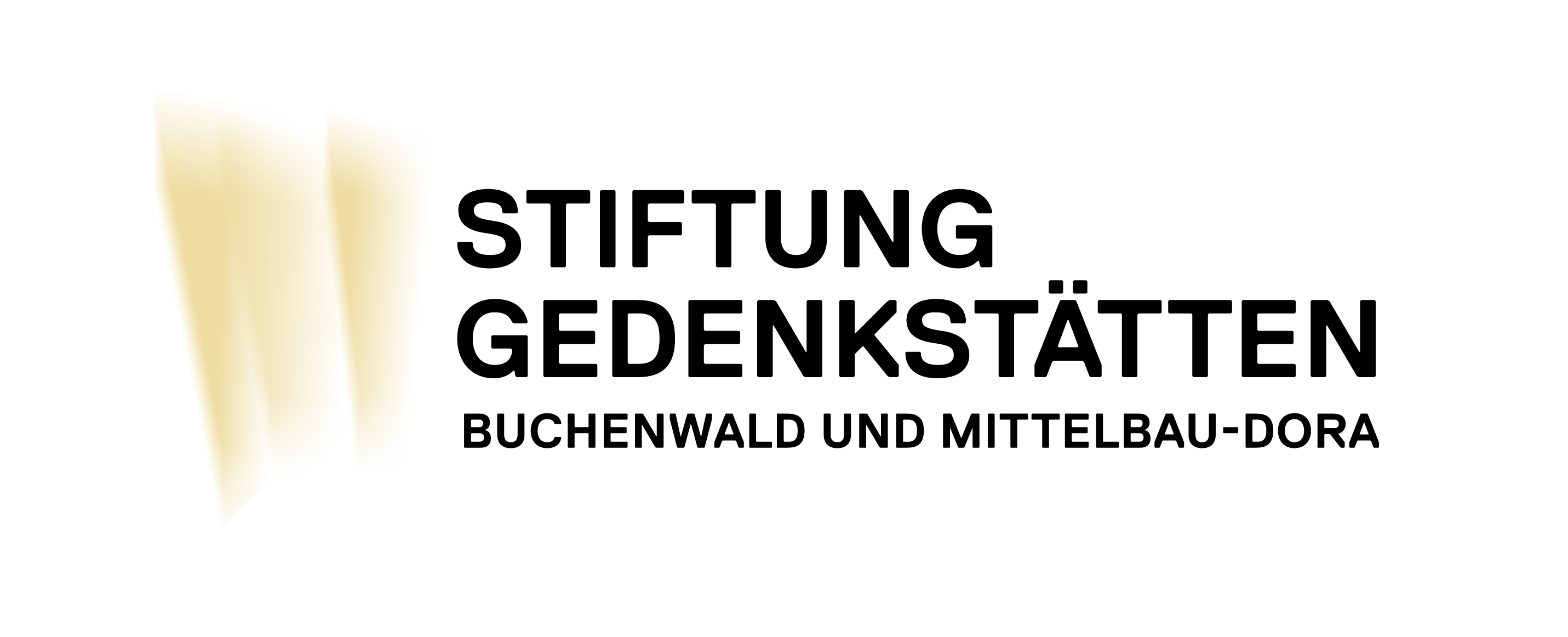Die Fotos von den Werkstätten sollten die Effizienz der Produktion im Ghetto Litzmannstadt belegen. Auf manchen ist jedoch der schlechte gesundheitliche Zustand der Ghettoinsassen deutlich zu erkennen.
Foto: Mendel Grosman / Henryk Ross
©Archiwum Państwowe w Łodzi Foto Mendel Grosman / Henryk Ross

Als Lehrlinge in die „kriegswichtige“ Produktion des Ghettos eingegliedert, konnten Kinder über zehn Jahren zunächst vor der Deportation ins Vernichtungslager geschützt werden.
Foto: Mendel Grosman / Henryk Ross
©Archiwum Państwowe w Łodzi

Obwohl die Werkstätten des Ghettos Litzmannstadt für die Wehrmacht arbeiteten, lieferten die Deutschen nicht genug Nahrung in das Ghetto. Auch nach der Einführung öffentlicher Küchen verhungerten täglich Menschen.
Foto: Mendel Grosman / Henryk Ross
Frauen, Männer und Kinder arbeiteten bis zur völligen Erschöpfung in den Ghettowerkstätten. Chaim Rumkowski, der von Stadtkomissar Albert Leister eingesetzte Vorsitzende der jüdischen Verwaltung, hatte sie aufbauen lassen. Mit Aufträgen der Wehrmacht versuchte er, die Arbeiter:innen der Werkstätten für die Besatzer unentbehrlich zu machen, um zumindest einige der Ghettoinsass:innen zu retten.
Doch die städtische Ghettoverwaltung unter Hans Biebow lieferte zu wenig Lebensmittel. So starb ein Viertel der 200 000 Menschen im Ghetto Litzmannstadt an Hunger und Krankheiten. Zudem ließ die SS Kranke, Kinder unter zehn Jahren und ältere Menschen als „nicht arbeitsfähig“ in das Vernichtungslager Kulmhof deportieren. Im Sommer 1944 ordnete SS-Chef Himmler die Deportation der noch lebenden Ghettoinsass:innen nach Auschwitz an. Damit scheiterte die Strategie der Rettung durch Arbeit endgültig.

©Archiwum Państwowe w Łodzi

©Archiwum Państwowe w Łodzi

Aufzählung der Textilien, die für den Reichsarbeitsdienst angefertigt wurden.
©Archiwum Państwowe w Łodzi