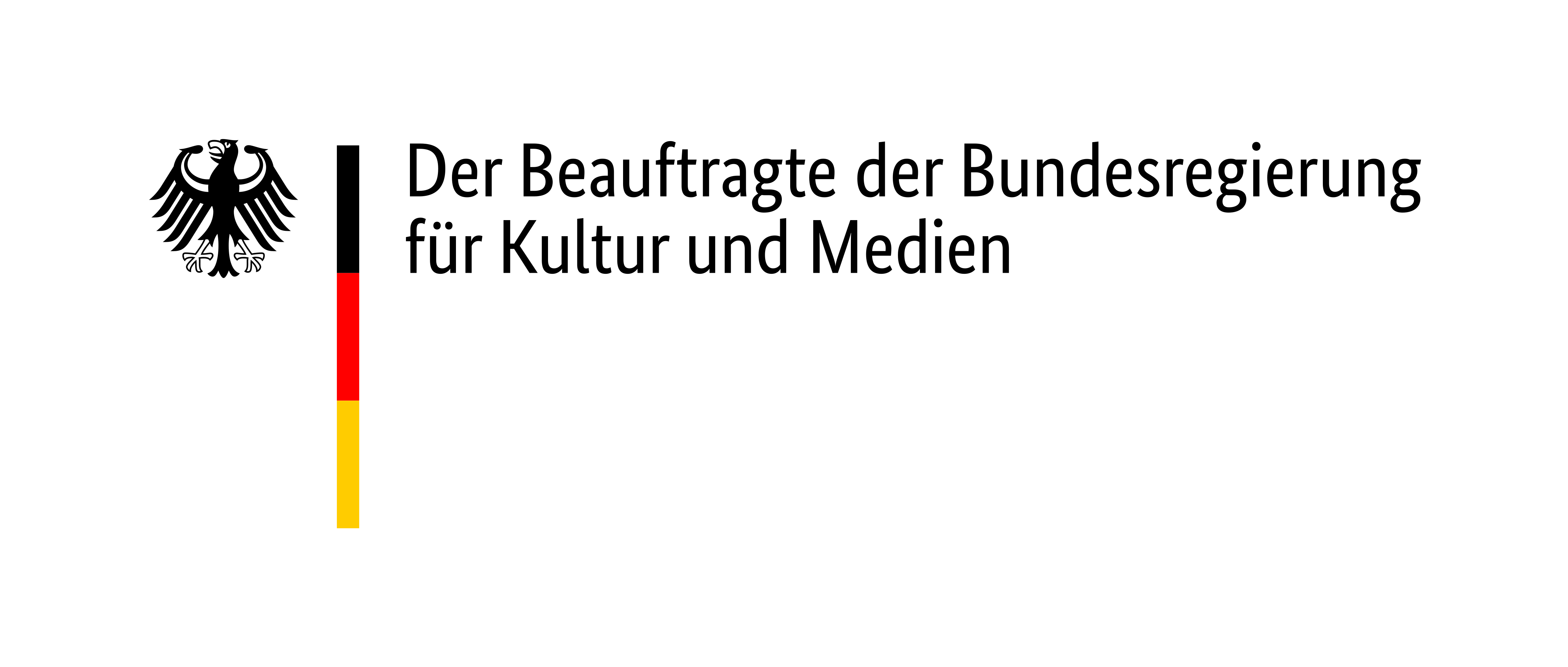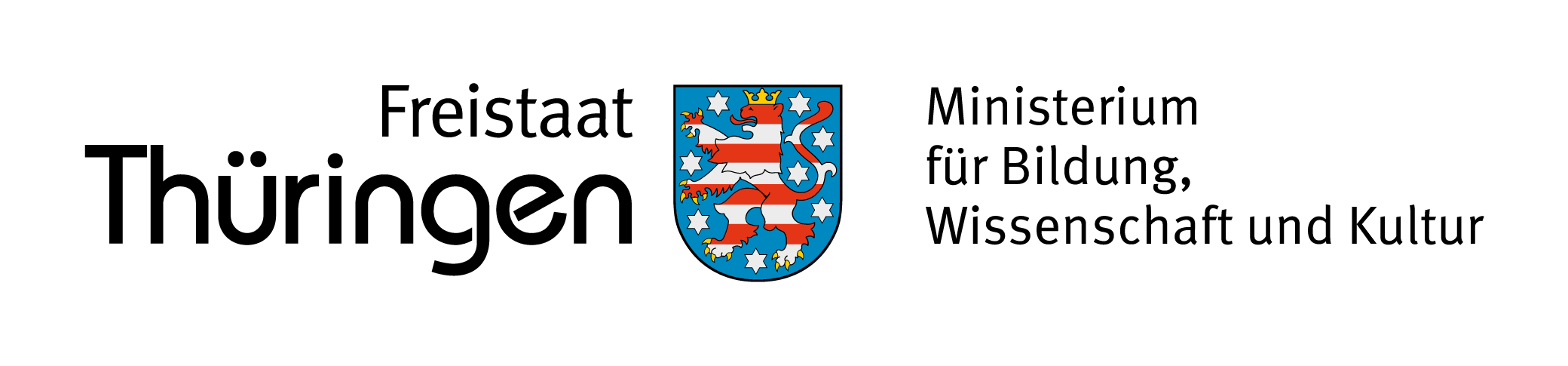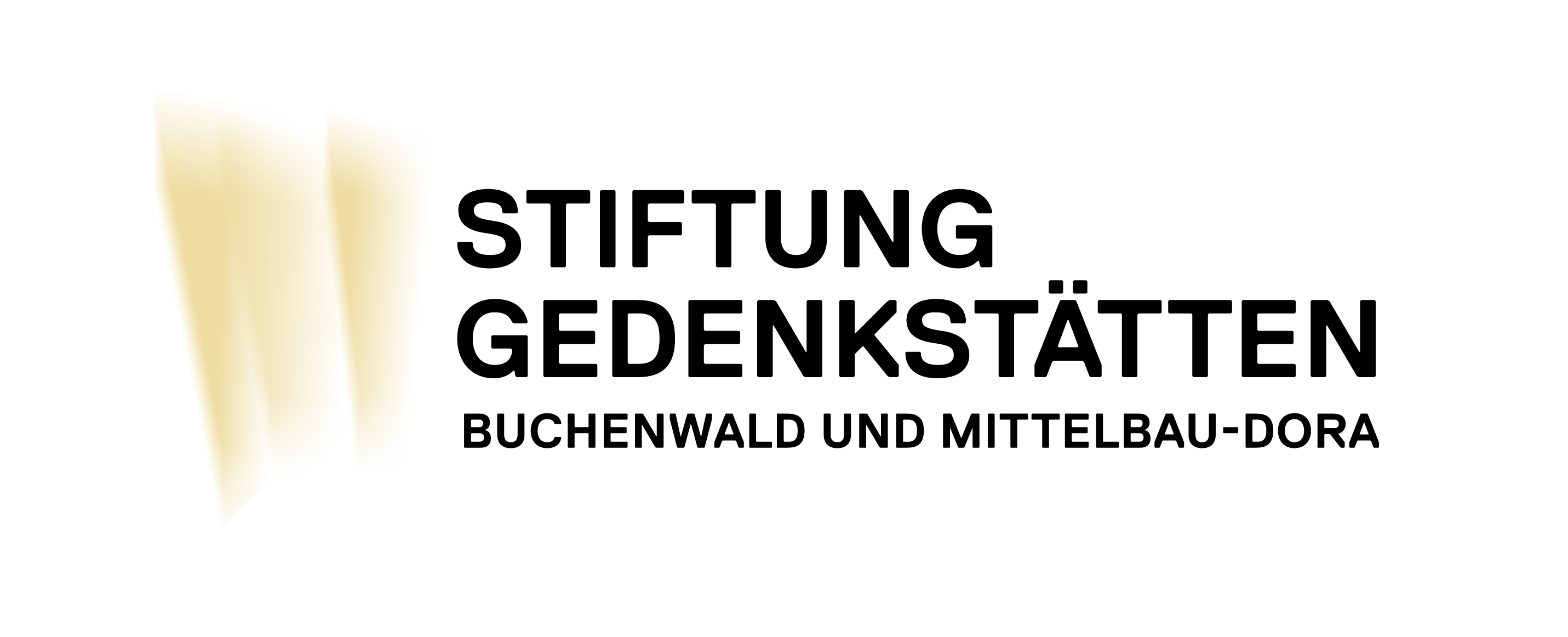1/3
Ein US-Soldat mit befreiten russischen Zwangsarbeitern, Ulm 1945.
Die Schlagzeile der Zeitung lautet: „Sowjets in Berlin“.
©National Archives, Washington
Die Schlagzeile der Zeitung lautet: „Sowjets in Berlin“.
©National Archives, Washington
2/3
Unbekannter Ort, März 1945.
Der Pole Jan Jakubasik unmittelbar nach seiner Befreiung. Er wurde seit 1942 im Deutschen Reich zur Zwangsarbeit eingesetzt.
©National Archives, Washington
Der Pole Jan Jakubasik unmittelbar nach seiner Befreiung. Er wurde seit 1942 im Deutschen Reich zur Zwangsarbeit eingesetzt.
©National Archives, Washington
3/3
Poznań, März 1945.
Befreite Zwangsarbeiter:innen der Focke-Wulf-Flugzeugwerke in der Nähe von Posen begrüßen Soldaten der Roten Armee.
Foto: Boris Puschkin
©Deutsches Historisches Museum Berlin
Befreite Zwangsarbeiter:innen der Focke-Wulf-Flugzeugwerke in der Nähe von Posen begrüßen Soldaten der Roten Armee.
Foto: Boris Puschkin
©Deutsches Historisches Museum Berlin
Der Zweite Weltkrieg endete in Europa am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Die Alliierten unterstützten die Millionen ehemaliger Zwangsarbeiter:innen so gut es ging. Doch häufig genug bestimmte Not und Angst vor der Zukunft deren Alltag. Die Mehrheit der Deutschen wollte die befreiten Zwangsarbeiter:innen so schnell wie möglich loswerden.
In Ulm erlebte die 17jährige Polin Gabriela Knapska im April 1945 ihre Befreiung. Sie schrieb in ihr Tagebuch: „Endlich! Endlich ist es so weit. Wir sind frei! Aber man weiß nicht, was noch alles passieren kann.“

Gabriela Turant geb. Knapska (links), geboren am 31. Mai 1927 in Łagiewniki / Śląskie (Oberschlesien) mit ihrer Zwillingsschwester Jolanta, 1944.
©Privatbesitz Gabriela Knapska